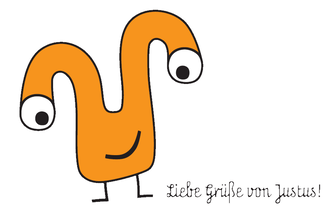Erste Ergebnisse
Information für Eltern und Lehrkräfte
|
Danksagung
Unser herzlicher Dank gilt allen an unserer Studie teilnehmenden Kindern sowie deren Eltern und insbesondere auch den Schulen und Lehrkräften. Ihre Offenheit für unsere Forschung und das außerordentliche Entgegenkommen haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Kindern eine große Freude war. |
Bildquelle: www.pexels.com
Hintergrund unserer Studie
Zum Thema (Un-)Gerechtigkeit gibt es noch viele offene Fragen. Mit unserer Studie sind wir zusammen mit den Kindern, Eltern und Lehrkräften auf die Suche nach Antworten gegangen. Damit sind wir gemeinsam zu Pionierinnen und Pionieren in diesem Bereich der psychologischen Forschung geworden. Schon Kinder unter zwei Jahren reagieren überrascht, wenn eine Verteilung ohne Grund ungleich ist oder eine fleißige Person das Gleiche bekommt wie eine faule Person. Solche Studienergebnisse zeigen, dass ein grundlegendes Verständnis für Gerechtigkeit schon früh vorhanden ist. Die Forschung an älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen hat aber auch gezeigt, dass sich Menschen darin unterscheiden, wie wichtig ihnen Gerechtigkeit überhaupt ist und wie sehr es ihnen etwas ausmacht, wenn sie Ungerechtigkeit erleben oder verursachen. Man spricht dann davon, dass Menschen unterschiedlich ungerechtigkeitssensibel sind. Es hat sich gezeigt, dass diese Unterschiede zwischen Menschen stabil sind, also über längere Dauer und in vielfältigen Situationen bestehen bleiben. Deswegen bezeichnet man Ungerechtigkeitssensibilität auch als Persönlichkeitseigenschaft. Bislang ist aber nicht bekannt, ob sich auch jüngere Kinder schon in der Ausprägung der Eigenschaft voneinander unterscheiden, denn viele Persönlichkeitseigenschaften prägen sich erst im Verlauf der Entwicklung aus. Mit unserer Studie wollten wir mehr zur Wahrnehmung von Ungerechtigkeit im Kindesalter herausfinden. Wir wollten wissen: Unterscheiden sich bereits Kinder zwischen 6 und 10 Jahren in ihrer Wahrnehmung von Ungerechtigkeit und in den Reaktionen auf sie? Woher kommen diese Unterschiede und können sie schon im Kindesalter zuverlässig gemessen werden? Wie hängen sie mit pro- und antisozialem Verhalten zusammen? So möchten wir mehr über die Entwicklung der Persönlichkeitseigenschaft Ungerechtigkeitssensibilität im Kindesalter erfahren.
Stichprobe
Für die Studie wurden 1331 Kinder in der ersten bis vierten Klasse befragt. Es nahmen Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren teil, das Durchschnittsalter lag bei 8,05 Jahren. 51,3 % der TeilnehmerInnen waren weiblich, 47,4 % männlich und 1,3% gaben „anderes“ an. 841 Eltern füllten den Elternfragebogen in der Papier- oder der Onlineversion aus. Der Lehrerfragebogen wurde zu 1108 Kindern online oder als Papierversion beantwortet.
Zum Thema (Un-)Gerechtigkeit gibt es noch viele offene Fragen. Mit unserer Studie sind wir zusammen mit den Kindern, Eltern und Lehrkräften auf die Suche nach Antworten gegangen. Damit sind wir gemeinsam zu Pionierinnen und Pionieren in diesem Bereich der psychologischen Forschung geworden. Schon Kinder unter zwei Jahren reagieren überrascht, wenn eine Verteilung ohne Grund ungleich ist oder eine fleißige Person das Gleiche bekommt wie eine faule Person. Solche Studienergebnisse zeigen, dass ein grundlegendes Verständnis für Gerechtigkeit schon früh vorhanden ist. Die Forschung an älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen hat aber auch gezeigt, dass sich Menschen darin unterscheiden, wie wichtig ihnen Gerechtigkeit überhaupt ist und wie sehr es ihnen etwas ausmacht, wenn sie Ungerechtigkeit erleben oder verursachen. Man spricht dann davon, dass Menschen unterschiedlich ungerechtigkeitssensibel sind. Es hat sich gezeigt, dass diese Unterschiede zwischen Menschen stabil sind, also über längere Dauer und in vielfältigen Situationen bestehen bleiben. Deswegen bezeichnet man Ungerechtigkeitssensibilität auch als Persönlichkeitseigenschaft. Bislang ist aber nicht bekannt, ob sich auch jüngere Kinder schon in der Ausprägung der Eigenschaft voneinander unterscheiden, denn viele Persönlichkeitseigenschaften prägen sich erst im Verlauf der Entwicklung aus. Mit unserer Studie wollten wir mehr zur Wahrnehmung von Ungerechtigkeit im Kindesalter herausfinden. Wir wollten wissen: Unterscheiden sich bereits Kinder zwischen 6 und 10 Jahren in ihrer Wahrnehmung von Ungerechtigkeit und in den Reaktionen auf sie? Woher kommen diese Unterschiede und können sie schon im Kindesalter zuverlässig gemessen werden? Wie hängen sie mit pro- und antisozialem Verhalten zusammen? So möchten wir mehr über die Entwicklung der Persönlichkeitseigenschaft Ungerechtigkeitssensibilität im Kindesalter erfahren.
Stichprobe
Für die Studie wurden 1331 Kinder in der ersten bis vierten Klasse befragt. Es nahmen Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren teil, das Durchschnittsalter lag bei 8,05 Jahren. 51,3 % der TeilnehmerInnen waren weiblich, 47,4 % männlich und 1,3% gaben „anderes“ an. 841 Eltern füllten den Elternfragebogen in der Papier- oder der Onlineversion aus. Der Lehrerfragebogen wurde zu 1108 Kindern online oder als Papierversion beantwortet.
Bildquelle: www.shutterstock.com
Die Ergebnisse
1. Unterscheiden sich schon Kinder zwischen 6 und 10 Jahren in der Wahrnehmung von Ungerechtigkeit?
Wir haben durch unsere Befragungen herausgefunden, dass sich in der Tat schon 6- bis 10-Jährige in der Ungerechtigkeitssensibilität unterscheiden können: Kinder mit einer hohen Ausprägung der Opfersensibilität haben häufig das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden und reagieren dann meist ärgerlich und/oder traurig und müssen lange über diese Erlebnisse nachdenken. Kinder mit niedriger Opfersensibilität fühlen sich hingegen nicht so häufig benachteiligt, denken nicht viel über solche Erlebnisse nach und fühlen sich nicht besonders schlecht deswegen. Kinder mit einer hohen Beobachtersensibilität sind sehr sensibel dafür, dass andere ungerecht behandelt werden. Wenn sie dies beobachten, reagieren sie empört, da ihnen die beobachtete Ungerechtigkeit zu schaffen macht. Kinder mit niedriger Beobachtersensibilität nehmen Ungerechtigkeit zum Nachteil anderer dagegen eher selten wahr und reagieren nicht so empört. Kinder mit einer hohen Tätersensibilität fürchten, andere ungerecht zu behandeln und fühlen sich schuldig, wenn es ihnen doch einmal passiert. Kinder mit einer niedrigen Tätersensibilität haben dagegen nicht so oft das Gefühl, andere ungerecht zu behandeln und wenn, dann finden sie es nicht so schlimm. Dabei hängen Beobachter- und Tätersensibilität stärker miteinander zusammen als Opfersensibilität mit den beiden anderen Perspektiven. Das heißt, beobachtersensible Kinder sind häufig auch tätersensibel und umgekehrt, während opfersensible Kinder nicht unbedingt hohe Ausprägungen auf den beiden anderen Skalen zeigen. Das Wissen, dass sich schon Kinder in ihrem Empfinden für Ungerechtigkeiten unterscheiden, ist für uns sehr wertvoll: Denn nun können wir uns weiter damit beschäftigen, wie sich Ungerechtigkeitssensibilität entwickelt, wovon dies abhängt und welche Einflüsse sie hat. Dies geht allerdings nur dann, wenn es uns gelingt, Ungerechtigkeitssensibilität in diesem Alter auch zuverlässig zu messen.
1. Unterscheiden sich schon Kinder zwischen 6 und 10 Jahren in der Wahrnehmung von Ungerechtigkeit?
Wir haben durch unsere Befragungen herausgefunden, dass sich in der Tat schon 6- bis 10-Jährige in der Ungerechtigkeitssensibilität unterscheiden können: Kinder mit einer hohen Ausprägung der Opfersensibilität haben häufig das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden und reagieren dann meist ärgerlich und/oder traurig und müssen lange über diese Erlebnisse nachdenken. Kinder mit niedriger Opfersensibilität fühlen sich hingegen nicht so häufig benachteiligt, denken nicht viel über solche Erlebnisse nach und fühlen sich nicht besonders schlecht deswegen. Kinder mit einer hohen Beobachtersensibilität sind sehr sensibel dafür, dass andere ungerecht behandelt werden. Wenn sie dies beobachten, reagieren sie empört, da ihnen die beobachtete Ungerechtigkeit zu schaffen macht. Kinder mit niedriger Beobachtersensibilität nehmen Ungerechtigkeit zum Nachteil anderer dagegen eher selten wahr und reagieren nicht so empört. Kinder mit einer hohen Tätersensibilität fürchten, andere ungerecht zu behandeln und fühlen sich schuldig, wenn es ihnen doch einmal passiert. Kinder mit einer niedrigen Tätersensibilität haben dagegen nicht so oft das Gefühl, andere ungerecht zu behandeln und wenn, dann finden sie es nicht so schlimm. Dabei hängen Beobachter- und Tätersensibilität stärker miteinander zusammen als Opfersensibilität mit den beiden anderen Perspektiven. Das heißt, beobachtersensible Kinder sind häufig auch tätersensibel und umgekehrt, während opfersensible Kinder nicht unbedingt hohe Ausprägungen auf den beiden anderen Skalen zeigen. Das Wissen, dass sich schon Kinder in ihrem Empfinden für Ungerechtigkeiten unterscheiden, ist für uns sehr wertvoll: Denn nun können wir uns weiter damit beschäftigen, wie sich Ungerechtigkeitssensibilität entwickelt, wovon dies abhängt und welche Einflüsse sie hat. Dies geht allerdings nur dann, wenn es uns gelingt, Ungerechtigkeitssensibilität in diesem Alter auch zuverlässig zu messen.
2. Kann Ungerechtigkeitssensibilität schon im Kindesalter gemessen werden?
Häufig ist es schwer, jüngere Kinder zu ihrem Erleben und Verhalten zu befragen, denn oft sind sie sich ihres Verhaltens nicht bewusst. Es ist schwer für sie, ihr inneres Erleben in Worte zu fassen oder alle Fragen dazu zu verstehen. Bei unseren Befragungen haben wir deswegen verschiedene Strategien verfolgt: Wir haben den Kindern einen sehr einfach formulierten Fragebogen vorgelesen und sie nach ihrer eigenen Einschätzung gefragt. Außerdem haben wir auch die Eltern zu der Ungerechtigkeitssensibilität Ihrer Kinder befragt. Wir können sagen, dass uns deren Erfassung auf beiden Wegen gut gelungen ist: Die gefundenen Muster ähnelten denen im Jugend- und Erwachsenenalter. Zwischen den Einschätzungen der Eltern und denen der Kinder gab es kleine, aber bedeutsame Zusammenhänge, die mit zunehmendem Alter der Kinder deutlicher wurden. Dies stellt einen tollen Befund dar, da zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen nicht selten größere Unterschiede bestehen, eine Übereinstimmung aber die Gültigkeit der Selbsteinschätzungen unterstreicht. Dies zeigt, dass schon Kinder in diesem Altersbereich gut zu ihrer Ungerechtigkeitssensibilität befragt werden können, diese Angaben aber sinnvoll durch Fremdberichte ergänzt werden.
Häufig ist es schwer, jüngere Kinder zu ihrem Erleben und Verhalten zu befragen, denn oft sind sie sich ihres Verhaltens nicht bewusst. Es ist schwer für sie, ihr inneres Erleben in Worte zu fassen oder alle Fragen dazu zu verstehen. Bei unseren Befragungen haben wir deswegen verschiedene Strategien verfolgt: Wir haben den Kindern einen sehr einfach formulierten Fragebogen vorgelesen und sie nach ihrer eigenen Einschätzung gefragt. Außerdem haben wir auch die Eltern zu der Ungerechtigkeitssensibilität Ihrer Kinder befragt. Wir können sagen, dass uns deren Erfassung auf beiden Wegen gut gelungen ist: Die gefundenen Muster ähnelten denen im Jugend- und Erwachsenenalter. Zwischen den Einschätzungen der Eltern und denen der Kinder gab es kleine, aber bedeutsame Zusammenhänge, die mit zunehmendem Alter der Kinder deutlicher wurden. Dies stellt einen tollen Befund dar, da zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen nicht selten größere Unterschiede bestehen, eine Übereinstimmung aber die Gültigkeit der Selbsteinschätzungen unterstreicht. Dies zeigt, dass schon Kinder in diesem Altersbereich gut zu ihrer Ungerechtigkeitssensibilität befragt werden können, diese Angaben aber sinnvoll durch Fremdberichte ergänzt werden.
3. Woher kommen Unterschiede in der Ungerechtigkeitssensibilität?
Bislang ist nur wenig darüber bekannt, woher Unterschiede in der Ungerechtigkeitssensibilität rühren. Eine unserer Vermutungen war, dass diese als Folge des unterschiedlich häufigen Erlebens ungerechter Erfahrungen in der Schule oder in der Familie auftreten. Tatsächlich fanden wir solche Zusammenhänge vereinzelt: so zeigte sich, dass höhere Täter- und Beobachtersensibilität mit einem geringeren subjektiven Erleben von ungerechten Ereignissen in der Schule und der Familie einhergehen. Das bedeutet, dass täter- und beobachtersensible Kinder weniger das Gefühl haben, zuhause oder in der Schule benachteiligt zu werden. Ein wichtiger Faktor scheint auch die Ungerechtigkeitssensibilität der Eltern zu sein: Gemäß des Sprichworts Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, waren die von den Eltern eingeschätzten Ausprägungen der Kinder in den zuvor beschriebenen Perspektiven der Ungerechtigkeitssensibilität denen ihrer Eltern sehr ähnlich. Es gilt scheinbar, was bereits für allgemeine Wertvorstellungen bestätigt wurde: Kinder orientieren sich hinsichtlich ihrer Reaktionen auf Ungerechtigkeit stark an ihren Eltern. Es ist zudem zu vermuten, dass Eltern Reaktionen und Verhalten ihrer Kinder in ungerechten Situationen insbesondere dann fördern, wenn es ihren eigenen Werten entspricht.
Bislang ist nur wenig darüber bekannt, woher Unterschiede in der Ungerechtigkeitssensibilität rühren. Eine unserer Vermutungen war, dass diese als Folge des unterschiedlich häufigen Erlebens ungerechter Erfahrungen in der Schule oder in der Familie auftreten. Tatsächlich fanden wir solche Zusammenhänge vereinzelt: so zeigte sich, dass höhere Täter- und Beobachtersensibilität mit einem geringeren subjektiven Erleben von ungerechten Ereignissen in der Schule und der Familie einhergehen. Das bedeutet, dass täter- und beobachtersensible Kinder weniger das Gefühl haben, zuhause oder in der Schule benachteiligt zu werden. Ein wichtiger Faktor scheint auch die Ungerechtigkeitssensibilität der Eltern zu sein: Gemäß des Sprichworts Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, waren die von den Eltern eingeschätzten Ausprägungen der Kinder in den zuvor beschriebenen Perspektiven der Ungerechtigkeitssensibilität denen ihrer Eltern sehr ähnlich. Es gilt scheinbar, was bereits für allgemeine Wertvorstellungen bestätigt wurde: Kinder orientieren sich hinsichtlich ihrer Reaktionen auf Ungerechtigkeit stark an ihren Eltern. Es ist zudem zu vermuten, dass Eltern Reaktionen und Verhalten ihrer Kinder in ungerechten Situationen insbesondere dann fördern, wenn es ihren eigenen Werten entspricht.
4. Wie wirken sich Unterschiede in der Ungerechtigkeitssensibilität auf Verhalten und Erleben von Kindern aus?
Neben Ungerechtigkeitssensibilität haben wir auch Informationen über andere Verhaltensweisen der Kinder erfasst. Dabei stießen wir auf Zusammenhänge, die bereits aus der Forschung mit Jugendlichen und Erwachsenen bekannt sind. Es ist erfreulich, diese Zusammenhänge nun auch bei den jüngeren Kindern zu beobachten, da dies ein weiterer wichtiger Hinweis darauf ist, dass Ungerechtigkeitssensibilität schon bei diesen zuverlässig gemessen werden kann. So hat sich gezeigt, dass Kinder, die besonders sensibel darauf reagieren, selbst Ungerechtigkeit zu verursachen oder diese zu beobachten, häufig auch verstärkt prosoziales Verhalten (z.B. die Bereitschaft zu teilen und zu helfen) zeigen. Kinder, die sich häufig als Opfer von Ungerechtigkeit fühlen, zeigen hingegen weniger prosoziales Verhalten. Unabhängig von der Perspektive weisen ungerechtigkeitssensible Kinder hohe sozial-emotionale Kompetenzen auf. Sie können sich also gut in andere einfühlen oder diese verstehen. Kinder, die sich häufig selbst ungerecht behandelt fühlen, also hoch opfersensibel sind, neigen jedoch eher zu aggressivem Verhalten. Wie auch in älteren Stichproben zeigte sich, dass Opfersensibilität positiv mit relationaler Gewalt (z.B. lästern) und verbaler Gewalt (z.B. beleidigen) zusammenhängt, sowie mit dem Gesamtlevel Aggression. Vermutlich wollen sich opfersensible Kinder gegen wahrgenommene Ungerechtigkeit verteidigen oder dieser vorbeugen. Es zeigen sich auch deutliche Zusammenhänge zu einem verminderten Aggressionsniveau bei tätersensiblen Kindern. Diese weisen sowohl signifikant geringere physische, relationale und verbale Aggression auf und sind auch im Gesamtlevel dieser drei Aggressionsarten signifikant reduziert. Wir hatten außerdem die Lehrpersonen gebeten, die Kinder in Grammatik, Konzentration, Merkfähigkeit, Lesen, Rechtschreibung, Rechenfertigkeiten und im logischem Denken auf einer Skala von 1 bis 6 entsprechend der Schulnoten einzustufen. Die Skala kann als Indikator für die kognitive und akademische Leistungsfähigkeit des Kindes herangezogen werden. Es zeigte sich, das beobachter- und tätersensible Kinder signifikant besser über alle Indikatoren der kognitiven Leistungsfähigkeit hinweg einschätzt wurden als Kinder mit geringer Ausprägung auf diesen Perspektiven.
Neben Ungerechtigkeitssensibilität haben wir auch Informationen über andere Verhaltensweisen der Kinder erfasst. Dabei stießen wir auf Zusammenhänge, die bereits aus der Forschung mit Jugendlichen und Erwachsenen bekannt sind. Es ist erfreulich, diese Zusammenhänge nun auch bei den jüngeren Kindern zu beobachten, da dies ein weiterer wichtiger Hinweis darauf ist, dass Ungerechtigkeitssensibilität schon bei diesen zuverlässig gemessen werden kann. So hat sich gezeigt, dass Kinder, die besonders sensibel darauf reagieren, selbst Ungerechtigkeit zu verursachen oder diese zu beobachten, häufig auch verstärkt prosoziales Verhalten (z.B. die Bereitschaft zu teilen und zu helfen) zeigen. Kinder, die sich häufig als Opfer von Ungerechtigkeit fühlen, zeigen hingegen weniger prosoziales Verhalten. Unabhängig von der Perspektive weisen ungerechtigkeitssensible Kinder hohe sozial-emotionale Kompetenzen auf. Sie können sich also gut in andere einfühlen oder diese verstehen. Kinder, die sich häufig selbst ungerecht behandelt fühlen, also hoch opfersensibel sind, neigen jedoch eher zu aggressivem Verhalten. Wie auch in älteren Stichproben zeigte sich, dass Opfersensibilität positiv mit relationaler Gewalt (z.B. lästern) und verbaler Gewalt (z.B. beleidigen) zusammenhängt, sowie mit dem Gesamtlevel Aggression. Vermutlich wollen sich opfersensible Kinder gegen wahrgenommene Ungerechtigkeit verteidigen oder dieser vorbeugen. Es zeigen sich auch deutliche Zusammenhänge zu einem verminderten Aggressionsniveau bei tätersensiblen Kindern. Diese weisen sowohl signifikant geringere physische, relationale und verbale Aggression auf und sind auch im Gesamtlevel dieser drei Aggressionsarten signifikant reduziert. Wir hatten außerdem die Lehrpersonen gebeten, die Kinder in Grammatik, Konzentration, Merkfähigkeit, Lesen, Rechtschreibung, Rechenfertigkeiten und im logischem Denken auf einer Skala von 1 bis 6 entsprechend der Schulnoten einzustufen. Die Skala kann als Indikator für die kognitive und akademische Leistungsfähigkeit des Kindes herangezogen werden. Es zeigte sich, das beobachter- und tätersensible Kinder signifikant besser über alle Indikatoren der kognitiven Leistungsfähigkeit hinweg einschätzt wurden als Kinder mit geringer Ausprägung auf diesen Perspektiven.
|
Fazit und Ausblick
Die Ergebnisse der vorliegenden Erhebung der JUST-Studie lassen erste Rückschlüsse zur Messbarkeit und Entwicklung der Ungerechtigkeitssensibilität im mittleren Kindesalter zu. Da es sich nur um querschnittliche Korrelationen handelt, können noch keine Ursache-Wirkungs-Aussagen formuliert werden. Die Korrelationen zeigen aber, dass Beobachter- und Tätersensibilität mit einer fortgeschrittenen sozial-emotionalen und sozial-kognitiven Entwicklung zusammenzuhängen scheint. Kinder, denen Gerechtigkeit für andere wichtig ist, scheinen sich besser in andere hineinversetzten und ihre eigenen mentalen Zustände und Verhaltensweisen besser regulieren zu können. Auch die kognitive Leistungsfähigkeit scheint stärker ausgeprägt. Möglicherweise kommt Beobachter- und Tätersensibilität eine „Schutzfunktion“ in schwierigen sozialen Situationen zu. Betrachtet man die Angaben der Eltern, finden sich hier jedoch auch Hinweise auf positive Zusammenhänge zwischen Opfersensibilität und verschiedenen sozialen Kompetenzen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass opfersensible Kinder ebenfalls über gute Fertigkeiten verfügen, sich in andere hineinzuversetzen und auch aus diesem Grund feinfühlig auf Verstöße gegen gerechtigkeitsbezogene Normen reagieren. Daher ist es wichtig, Opfersensibilität nicht ausschließlich negativ zu betrachten, zumal sie Kindern auch dabei helfen kann, sich dagegen zu schützen, von anderen ausgenutzt zu werden. Auch dies ist im Schulkontext und beim Aufbau langfristiger, stabiler Freundschaftsbeziehungen von Bedeutung. Damit wir in der Lage sind, Zusammenhänge nicht nur zu beschreiben, sondern erklärende und vorhersagende Aussagen zur Entstehung bzw. Entwicklung von Ungerechtigkeitssensibilität und ihren verhaltensrelevanten Aspekten tätigen zu können, müssen wir uns Entwicklungsverläufe über die Zeit ansehen. Daher wird die JUST-Studie ab Mai 2019 mit der zweiten Erhebungswelle fortgesetzt. Wir freuen uns auf eine erneute tolle Zusammenarbeit mit den an der JUST-Studie teilnehmenden Schulen, LehrerInnen und natürlich den Kindern! |
Bildquelle: www.pixabay.com
|
Bildquelle: JUST Studie